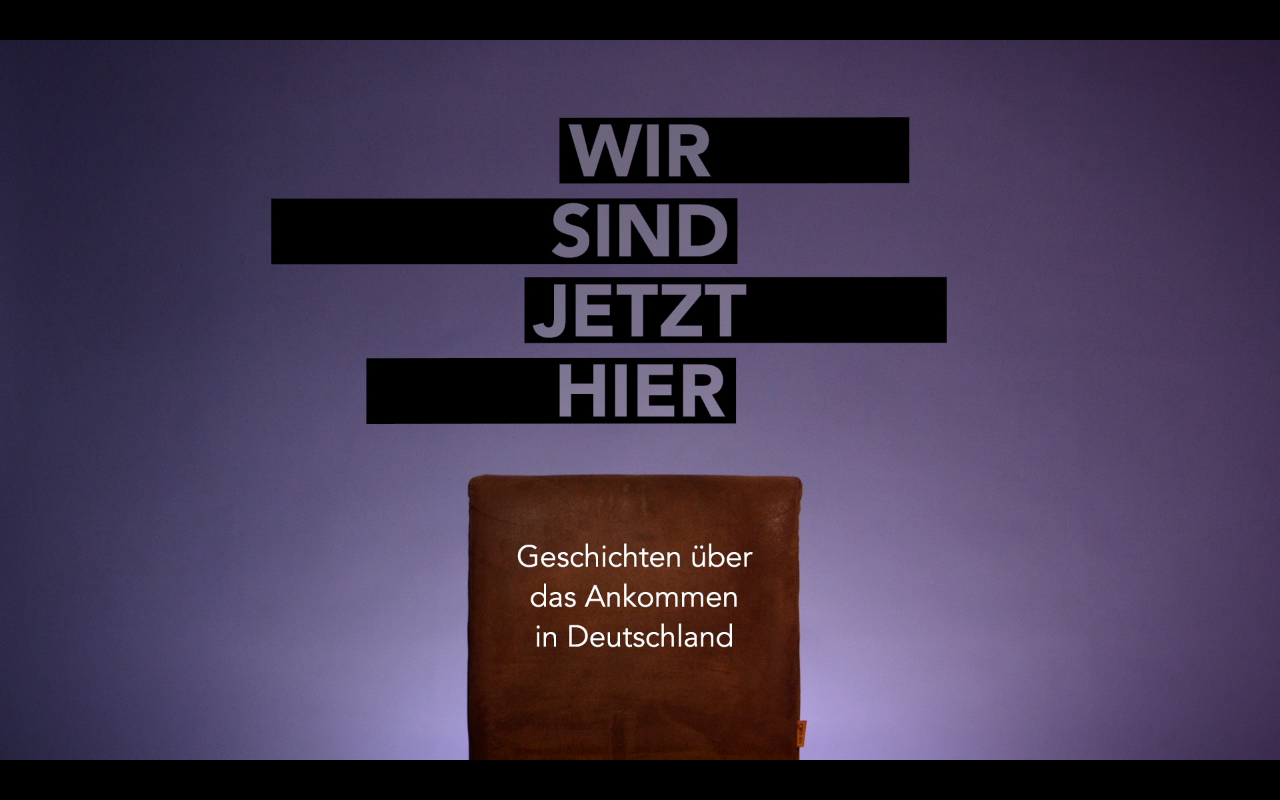Als 2015 mehr als 800.000 Geflüchtete nach Deutschland kamen, waren sie die Angstgegner aller Integrationsskeptiker*innen: Junge Männer, die allein aus Syrien oder Afghanistan, aus Somalia, Eritrea oder dem Irak nach Deutschland kamen. Sie wurden zur Projektionsfläche genauso für ernsthafte Sorgen wie für plumpen Rassismus.
Zugleich wurde viel häufiger über sie gesprochen als mit ihnen – und genau dort setzt der Film "Wir sind jetzt hier" von Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenck an. Sieben junge Männer erzählen in die Kamera vom Ankommen in Deutschland – von lustigen und beglückenden Momenten und von Momenten tiefster Verzweiflung, von ihren Ängsten und wie sie mit ihnen umgegangen sind, von Rassismus und von der Liebe. Ihre Geschichten lassen die Zuschauer*innen teilhaben an den emotionalen Turbulenzen, die eine Flucht fast immer nach sich zieht und sie erzählen viel darüber, was es auch in den nächsten Jahren noch braucht, damit Integration gelingt.
Im Interview mit der Interkulturellen Woche spricht Niklas Schenck über die Idee zum Film, über Vorurteile und Klischees und darüber, wie er und seine Frau plötzlich Pflegeeltern eines jungen Geflüchteten wurden.
Wie ist die Idee zum Film "Wir sind jetzt hier" entstanden?
Das war vor allem die Erfahrung, die wir mit unserem Pflegesohn Hasib Azizi gemacht haben. Wir haben ihn in Afghanistan kennengelernt, wo wir 2013 und 2014 gelebt haben und ihn auf den letzten Metern seiner Flucht nach Deutschland unterstützt. Als er 2015 als 16-Jähriger ankam, haben wir ihn bei uns in Hamburg aufgenommen. Im Frühjahr 2020 hat er uns eröffnet, dass er ausziehen und auf eigenen Füßen stehen möchte. Damit hat sich für uns als Familie ein Kreis geschlossen. Und wir haben festgestellt, dass sich unsere Erfahrung mit ihm so überhaupt nicht deckt mit dem, was in vielen Medien mit dem Bild von jungen männlichen Geflüchteten transportiert wird. So kam die Idee auf, sieben junge Männer selbst erzählen zu lassen, was sie erlebt haben.
Wie wurden sie zu Hasibs Pflegeeltern?
Als er in Deutschland ankam, wurde er zunächst in Hamburg in einem Lager untergebracht, was sehr belastend für ihn war. Er konnte kaum schlafen mit zehn Leuten in einem Zimmer und war immer völlig fertig, wenn er uns am Wochenende besucht hat. Wir haben schließlich die Vormundschaft übernommen, damit wir ihn bei Behördengängen unterstützen konnten. Dass wir ihn komplett zu uns nehmen, war in Hamburg nicht vorgesehen. Wir haben es einfach getan und danach neun Monate gebraucht, bis das Jugendamt uns offiziell als Pflegeeltern anerkannt hat.
Wie haben Sie die anderen Protagonisten gefunden?
Einige kannten wir bereits aus Hasibs Schulklasse. Den Künstler Azim Fakhri hatten wir in Kabul kennengelernt, die anderen haben wir über Kontakte in Hamburg gefunden. In den Interviews haben wir zunächst keine Fragen gestellt, sondern gesagt „Erzähl mal von Tag 1 an, was Du erlebt hast“. Damit wollten wir erfahren, was die Männer wirklich beschäftigt.
Im Film sind nur junge Männer zu sehen. Warum?
Wir haben sehr deutlich wahrgenommen, dass alleinstehende junge geflüchtete Männer die Projektionsfläche für viel Hass und Propaganda waren und gleichzeitig für viele Ängste in Teilen der Bevölkerung – sogar bei Menschen, die Geflüchteten gegenüber wohlwollend eingestellt waren. Dem wollten wir etwas entgegensetzen. Denn die jungen Männer spüren diese Vorbehalte sehr deutlich, auch schon, bevor sie die deutsche Sprache beherrschen. Sie merken, dass sie anders gesehen werden, dass man ihnen feindseliger gegenübertritt. Hasib wurde allein aufgrund seines Aussehens auf der Straße angesprochen und fertiggemacht und viele Dutzende Male verdachtsunabhängig von der Polizei kontrolliert – und er hat natürlich gemerkt, dass wir nie kontrolliert wurden.
Haben Sie durch die persönliche Erfahrung selbst noch dazulernen müssen, was die Situation für junge männliche Geflüchtete in Deutschland angeht?
Ich war als Nicht-Betroffener glaube ich typisch in der Haltung, dass Rassismus kein flächendeckendes Problem sei. Ein Beispiel: Hasib hat gesehen, dass bei uns im Park eine Hütte brannte und die Polizei gerufen. Wir sind zusammen mit ihm zum Revier gefahren, um die Aussage zu machen – und plötzlich fängt der Beamte an, Hasib wie einen Beschuldigten zu befragen, obwohl völlig klar war, dass er mit dem Brand nichts zu tun haben konnte. Bei Lehrerinnen und Lehrern haben wir die Haltung erlebt, dass junge Geflüchtete ohnehin nicht mehr schaffen können als den Hauptschulabschluss. Damit nimmt man ihnen die individuelle Freiheit, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Hasib wollte Groß- und Einzelhandelskaufmann werden, dafür brauchte er einen Realschulabschluss. Das hat er geschafft, zusammen mit zwei weiteren Protagonisten aus dem Film und anderen aus seiner Klasse.
Wie kann Ihr Film dazu beitragen, diese Vorurteile und Klischees abzubauen?
Menschen, die Zweifel oder Ängste haben, ändern Ihre Meinung oder Haltung nicht durch das richtige Argument, sondern nur durch direkten Kontakt. Wenn sie sich das nicht trauen oder wenn sich das für sie nicht ergibt, kann unser Film – wenn er diese Menschen erreicht, was nicht einfach ist – der beste Ersatz sein. Denn wir schaffen diesen Kontakt, indem die Protagonisten direkt in die Kamera sprechen. Durch den einfarbigen Hintergrund konzentrieren wir uns nur auf die Person, auf den Menschen, und es entsteht eine gewisse Vertrautheit.

Welche Erzählungen haben Sie beim Drehen besonders berührt?
Da gab es mehrere. Ganz sicher gehört die Szene dazu, in der Hasib eine dreitägige Waffenruhe in Afghanistan beschreibt und wie aufgeregt er war. Er hat sofort Pläne gemacht und Träume geträumt, was er dort machen kann, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. Da war eine unglaubliche Energie zu spüren, wir haben das damals in Hamburg und bei Freunden in Kabul quasi live mitbekommen. Nach drei Tagen ging der Krieg jedoch wieder weiter, und alle waren desillusioniert. Mit Azim waren wir auch am Flughafen, als er seine Familie endlich wiedergesehen hat. Ich habe mit dem Handy gedreht und die ganze Zeit geheult, darum wackelt das im Film so.
Mit welchen Hürden und Schwierigkeiten haben junge Geflüchtete in Deutschland zu kämpfen?
Wir haben das exemplarisch bei Hasib erlebt: Er kam mit einer unglaublichen Energie hierher. Auf seiner gefährlichen Reise hatte er gemerkt, dass seine eigene Initiative ihn weiterbringt, immer ins nächste Land. Unterwegs hat er sich ein GPS-Gerät besorgt anstatt noch einen Schmuggler zu bezahlen und damit sich und noch eine Familie über die ungarische Grenze gelotst. Die erste Erfahrung, die er in Deutschland machte, war: Von meiner Initiative hängt hier gar nichts ab. Egal, wie viel ich gebe, ich laufe wie gegen eine Wand. Bis mein Verfahren geklärt ist, darf ich nicht arbeiten, ich darf nicht in die Schule und als Afghane auch keinen Sprachkurs machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mein Antrag bewilligt wird, nur bei etwa 50 Prozent liegt.
Was müsste sich ändern?
Wir brauchen Verfahren, dass Menschen ihren Fall schon im Heimat- oder einem Transitland vortragen dürfen, und dann sicher hierher reisen können, wenn ihre Fluchtgründe anerkannt werden. Damit fällt die lebensgefährliche Fahrt über das Meer weg, und sie wissen, dass sie gleich durchstarten können, wenn sie hier sind. Von den sieben Menschen im Film sind sechs auf irregulären Wegen nach Deutschland gekommen. Sie haben ihr Leben riskiert, sind selbst fast gestorben und haben andere Menschen sterben sehen. Sie sind festgehalten, gekidnappt und gefoltert worden. Das erzählen wir im Film nicht, aber es ist Teil ihrer Geschichte. Allen ist hier Schutz zugesprochen worden – aber damit das geprüft wird, mussten sie irregulär herkommen. Diesen Widerspruch müssen wir auflösen.
Wie könnte das gehen?
Ein Weg könnten Resettlement-Programme sein, bei denen sich Paten melden können, die für die Geflüchteten bürgen, die über das Programm ins Land kommen und sie unterstützen. Das können Kirchengemeinden sein, Unternehmen oder ein Kreis von Privatpersonen. In Kanada ist das in einer Größenordnung von 0,05 Prozent der Bevölkerung pro Jahr möglich, das sind dort 20000 Personen. Auf Deutschland gerechnet wären das 42000 Menschen im Jahr, die sicher hierher kommen könnten. US-Präsident Joe Biden will das dortige Programm von null wieder auf 125000 Menschen pro Jahr hochfahren. Deutschland könnte mit diesen Ländern eine Achse bilden.
Wie fallen die Reaktionen auf den Film aus?
Der Film wurde durch die Friedrich-Ebert-Stiftung möglich gemacht und wird nun zur politischen Bildung eingesetzt, aber auch in ganz anderen Kontexten gezeigt, zum Beispiel bei DAX-Unternehmen. Auch im Unterricht wird er genutzt, und wir bekommen sehr positive Reaktionen von Lehrerinnen und Lehrern. Es ist auch schön zu sehen, wie wissbegierig die Leute den Kontakt zu den Protagonisten suchen, die fast immer in unterschiedlicher Besetzung beim Filmgespräch dabei sind. Beeindruckend sind auch die Reaktionen von Behördenleitern, die offen sagen, dass sie nach dem Film ganz anders auf die Geflüchteten schauen, mit denen sie seit Jahren professionell Umgang haben – weil sie eine ganz andere Dimension ihrer Situation kennengelernt haben.
Wie haben Sie Ihr Jahr in Kabul erlebt?
Ich habe eine Sache festgestellt: Wenn du dich nicht auf irgendwelche Institutionen verlassen kannst, greifst du fast zwangsläufig auf eine Solidarität von Familie zurück. Die positivsten Ausprägungen davon habe ich in Kabul kennengelernt, im Sinne von Gastfreundschaft, tiefem Interesse, Austausch, Familiensinn und -zusammenhalt. Ein Beispiel: Jemand erzählt mir, dass er seinen Möbelladen in der Immobilie des Onkels hat und ist komplett perplex, als ich frage, wie viel Miete er denn bezahlt. Denn er zahlt natürlich nichts, denn die Familie hält zusammen und wirft das Geld zusammen, um über die Runden zu kommen.
Inwiefern hat Sie diese Erfahrung geprägt?
Ich glaube, dass unsere Zeit in Kabul auf eine gewisse Art den Boden dafür bereitet hat, dass wir uns auf Hasib einlassen konnten, als uns das Leben diese Begegnung vor die Füße geworfen hat und wir Familie sein durften.
Weitere Informationen zum Film und zu Vorführungen gibt es hier.
Zur Person
Niklas Scheck, geboren 1983 in Heidelberg, ist ein mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer und investigativer Reporter. Er arbeitete er als freier Journalist für verschiedene Medien und machte eine Ausbildung an der renommierten Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Über die „Panorama“-Redaktion des Norddeutschen Rundfunks kam er zum Film. Für seine investigativen Recherchen wurde er mit dem Axel-Springer-Preis (2010) und dem Wächterpreis der Tagespresse (2012) ausgezeichnet, weitere Produktionen waren für den Grimmepreis und den Emmy nominiert. Mit seiner Frau Ronja von Wurmb-Seibel lebte er 2014 für ein Jahr in Kabul, daraus entstand ihr gemeinsamer Kino-Dokumentarfilm „True Warriors“ (2017). Im vergangenen Jahr erschien ihr zweiter Film „Wir sind jetzt hier“. Das Paar lebt auf dem Land in der Nähe von München.
Filmvorführungen und Gespräche mit den Macher*innen und Protagonisten sind im Rahmen der Interkulturellen Woche möglich.
Kontakt: schenck.niklas@gmail.com
Filmvorführungen und Gespräche mit den Macher*innen und Protagonisten sind im Rahmen der Interkulturellen Woche möglich.
Kontakt: schenck.niklas@gmail.com